Kategorie: Neuheiten
-
Barbecue Zéro Déchet : Fun, Savoureux et Responsable !

Organiser un barbecue ou un pique-nique Zéro Déchet, c’est avant tout une question de préparation et de bon sens. Découvrez quelques pistes concrètes pour un moment festif et responsable.
-
Der internationale Zero Waste Tag : Eine Einladung zum Engagement für eine grünere Zukunft

Anlässlich des Internationalen Zero Waste Tags, der seit 2022 jedes Jahr am 30. März stattfindet, ruft die Organisation der Vereinten Nationen (UN) uns dazu auf, unsere nicht nachhaltigen Produktions- und Konsumgewohnheiten zu überdenken, da sie verheerende Auswirkungen auf die Zukunft unseres Planeten haben. Der diesjährige Internationale Zero Waste Tag soll die Notwendigkeit von Massnahmen in…
-
Weniger Elektroschrott dank universellem USB-C Anschluss

Gute Nachrichten zum Thema Elektronikschrott!
-
Batch Cooking entdecken

Wenn Sie wenig Zeit haben und auch Ihre anderen Hobbys geniessen möchten, empfehlen wir Ihnen das Batch Cooking!
-
Meine Zero Waste Schule: ein Jahr danach
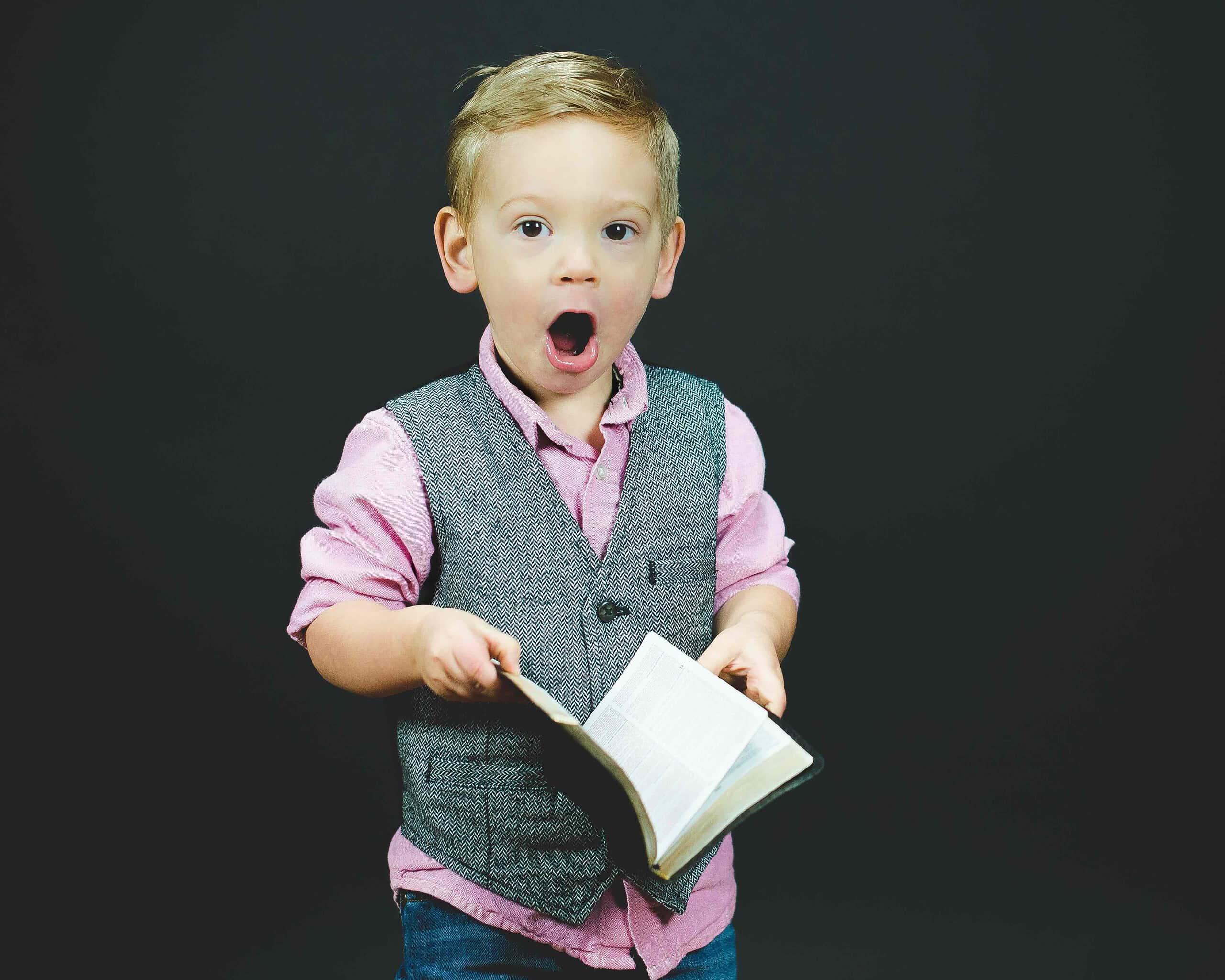
Vor etwa einem Jahr begann die Grund- und Sekundarschule von Apples-Bière und Umgebung mit dem Pilotprojekt Meine Zero Waste Schule (Mon École Zéro Déchet). Ursprünglich auf ein Jahr angelegt, befindet sich das Projekt nun in seinem zweiten Jahr – ein Beweis für seinen durchschlagenden Erfolg! Das Projekt wurde in mehreren Phasen durchgeführt. Zunächst erhielten die…
-
Konsumstudie 2023

Les pratiques historiquement présentées dans nos activités ont été bien admises par notre panel
-
ZeroWaste Switzerland ist Teil der Bewegung „Circular Economy Switzerland“
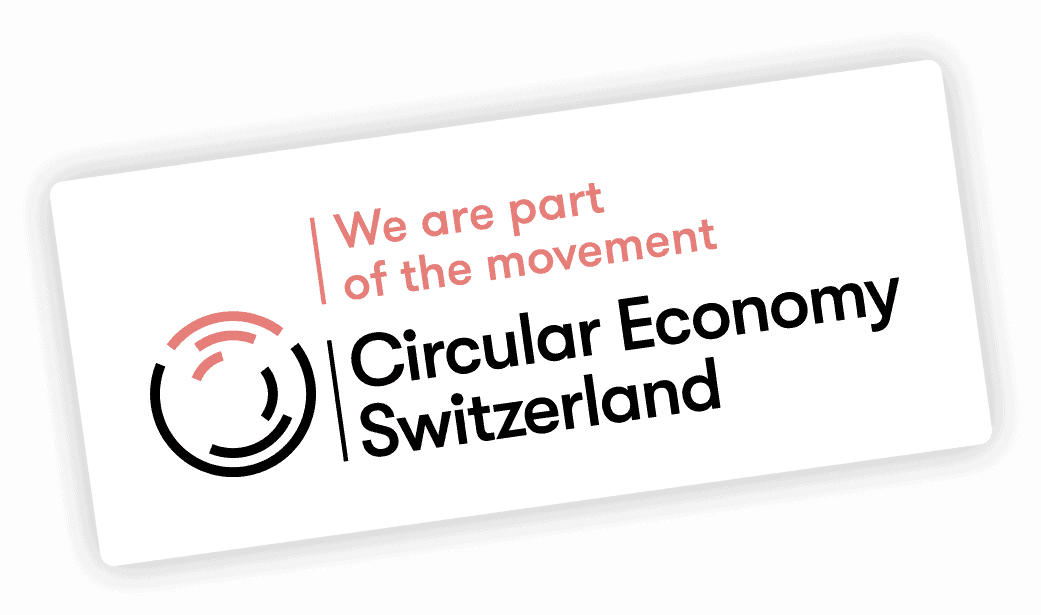
Circular Economy Switzerland (CES) ist eine Bewegung, die sich dafür einsetzt, der Kreislaufwirtschaft in der Schweiz neuen Schwung zu verleihen. Es handelt sich um eine Koordinations-, Austausch- und Vernetzungsplattform für die Kreislaufwirtschaft, die mit verschiedenen Projekten und Veranstaltungen als Katalysator auf Schweizer Ebene fungiert. Mehrere private Unternehmen und politische Organisationen verfolgen das gemeinsame Ziel, die…
-
ZeroWaste Switzerland engagiert sich mit der Koalition „Lang leben unsere Produkte“

Die Koalition “Lang leben unsere Produkte!“ wurde gegründet, um das Problem der Ressourcenverschwendung aufgrund der vorzeitigen Veralterung von Konsumgütern zu lösen. Trotz eines Konsenses über die Notwendigkeit, die Lebensdauer von Produkten zu verlängern, gibt es noch viele Hindernisse. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab beispielsweise, dass 97% der Befragten gut erhaltene Gegenstände wegwerfen mussten, weil Reparaturen…
-
Moins de déchets, c’est mieux pour le porte-monnaie

La Ville de Morges lance une campagne d’affichage concernant la réduction de déchets.
-
Parlamentswahlen 2023

Für die Natur abstimmen! Am 22. Oktober wählen wir unser Parlament neu. Damit entscheidende Veränderungen in Gang gesetzt werden, sollten Sie jetzt Ihren Wahlzettel ausfüllen! Seit Jahren hat die Umwelt in der Politik keine Priorität. Als Träger des Lebens auf unserem Planeten sollte sie jedoch nicht hinter finanziellen Erwägungen oder Freiheit zurückstehen. Damit jeder Mensch…
-
Re:Pas Challenge 2023
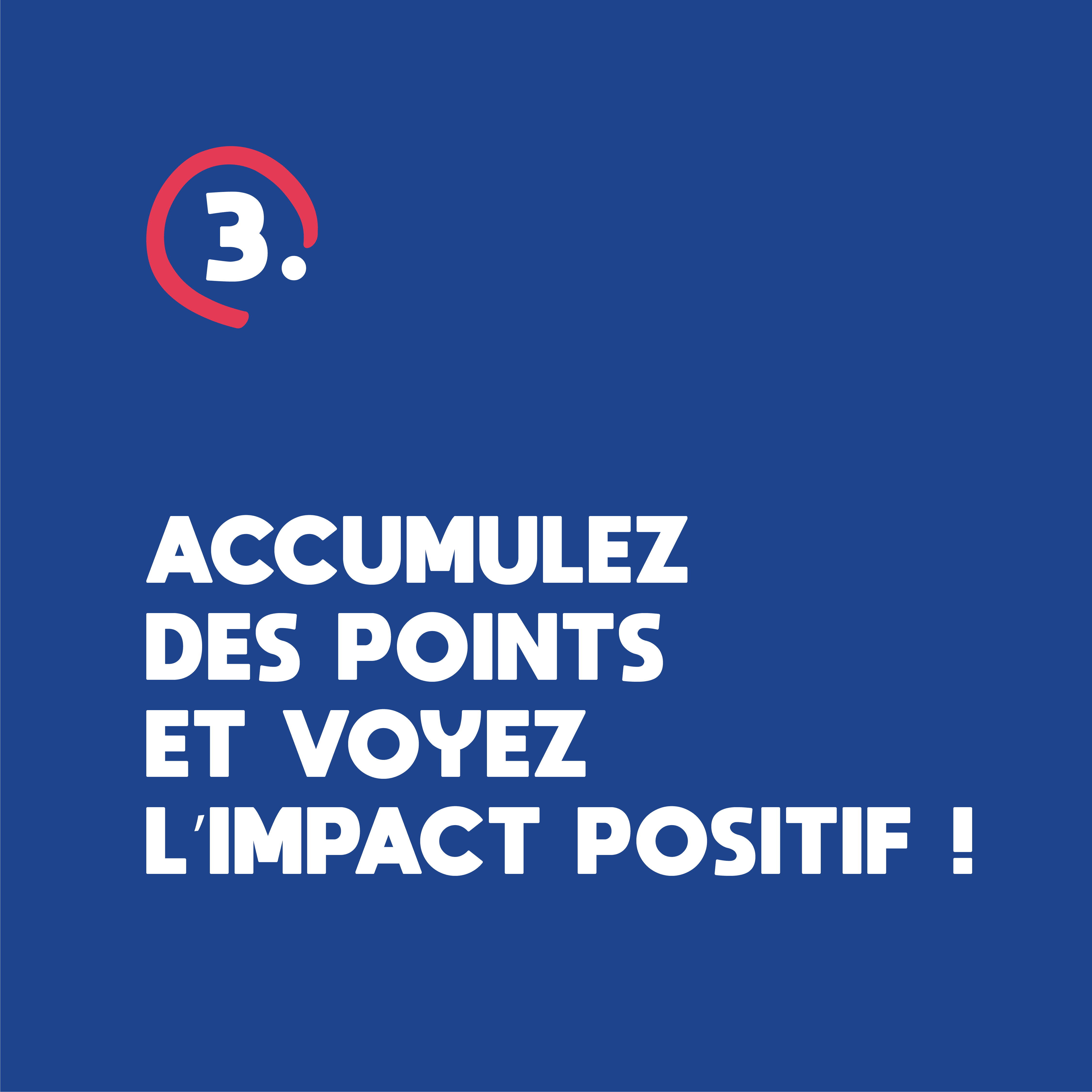
La Ville de Lausanne et le Canton de Genève, en partenariat avec l’association ZeroWaste Switzerland, s’allient autour d’un projet pilote à destination des entreprises, organisations et collectivités, visant les déchets liés à la restauration à emporter. RE:PAS CHALLENGE aura lieu du 18 septembre au 8 octobre, soit 3 semaines pour adopter la vaisselle réutilisable de…
-
Frohen Schweizer Nationalfeiertag!

Während wir uns darauf vorbereiten, am 1. August, den Schweizer Nationalfeiertag, zu feiern, gibt euch ZeroWaste Switzerland einige Tipps, wie ihr diesen besonderen Tag geniessen und gleichzeitig unsere Umwelt schonen könnt. Jedes Jahr können wir nicht nur unser Land feiern, sondern auch einen Beitrag zum Schutz der Luftqualität leisten. Laut Angaben des Bundesamtes für Polizei…